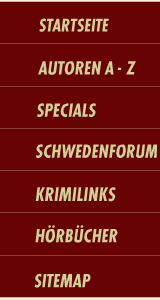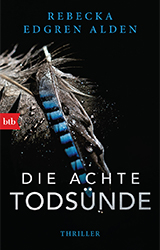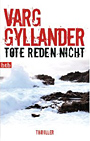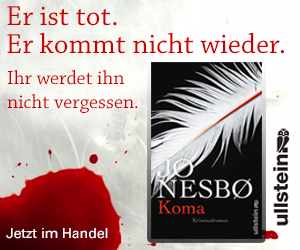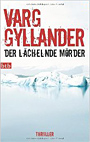Mord-Profi schreibt Krimis
„Ich habe den Geruch des Blutes in der Nase“
Schwedisches Blut schwappt wieder auf den deutschen Krimimarkt. „Tote reden nicht“ heißt das neue Buch des schwedischen Krimiautors Varg Gyllander. Und er weiß, wie man am besten mordet.
Als Pressesprecher der schwedischen Kriminalpolizei ist er kein blutiger Anfänger, denn tagtäglich begegnen ihm Mord- und Totschlag. Mit diesem Gratiszugang zu den schwersten Verbrechen hat er im Gegensatz zu vielen anderen Krimiautoren ein Insiderwissen, das seine Bücher sehr glaubwürdig und realistisch erscheinen lassen. „Ich habe den Geruch des Blutes immer in meiner Nase“. So sind viele Verbrechen in seinen Büchern der Polizeiakte entnommen. Den vermeintlichen Selbstmord einer Familie in seinem neuen Buch „Tote reden nicht“ hat er selbst hautnah miterlebt. Das zweite Verbrechen, eine von Piranhas angeknabberte Leiche im Swimmingpool eines Kreuzfahrtschiffes, entspringt dagegen seiner Phantasie. „Ich wohne auf einer Insel vor Stockholm und da liegt natürlich so eine Fischstory nahe“, lächelt der 48jährige. Diese zwei Verbrechen haben augenscheinlich zunächst nichts miteinander zu tun, hängen aber auf unheilvolle Weise zusammen.
| Buchtipp |
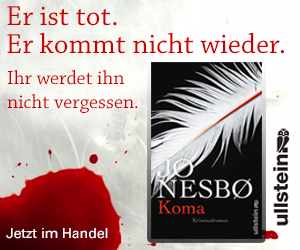 |
Kahlköpfig, in schwarzer Hose und weißem Hemd gibt sich Varg Gyllander auf seiner Lesereise durch Deutschland unkompliziert und fröhlich. Er ist ein charismatischer Typ, der auffällt. Ein unruhiger Geist, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. In der Schule hatte man ihm gesagt, er könne gar nicht schreiben, daher besuchte er vor ein paar Jahren einen Volkshochschulkurs im Krimi-Schreiben. Mittlerweile sind seine Bücher in mehrere Sprachen übersetzt worden. In Schweden ist gerade sein viertes Buch erschienen. Am fünften schreibt er bereits. „Ich muss ja schließlich alle Ideen, die ich in den bisherigen Büchern nicht unterbringen konnte, verwerten.“
DNA contra Bauchgefühl
Nicht nur das Insiderwissen, sondern auch Gyllanders Krimikonzept unterscheidet sich von den meisten anderen Schwedenkrimis. Seine Bücher sind CSI auf Schwedisch. Nicht der ermittelnde Kommissar steht im Mittelpunkt, sondern die modernen Spurenermittler, die Forensiker, die in Schutzanzügen, Pinsel und Pulver am Tatort werkeln. Gyllander war bereits von dieser Kriminaltechnik fasziniert und bestens mit ihr vertraut, bevor der Hype um die CSI-Fernsehserien losging. Bei einem Toten ohne Namen, Motiv und Verdächtigen kann die Aufklärung eines Falles buchstäblich an einem Haar hängen. Die Leiche verrät den Forensikern viel. So beschreibt Gyllander auf spannende Art und Weise, was zum Beispiel eine Pistolenkugel im Körper eines Toten alles über den Täter preisgeben kann.
Inzwischen steht Gyllander der modernen Spurensicherung aber auch kritisch gegenüber. „Diese Entwicklung wird noch mit einem Knall enden, da die herkömmliche Polizeiarbeit kaum noch zählt. DNA-Beweise werden vor Gericht nicht im Geringsten angezweifelt, dabei wird von den Tätern viel Unfug damit betrieben.“
So lässt er seine Hauptfigur, den Forensiker Ulf Holtz, verbittert räsonieren, dass seine jungen Kollegen von heute der Erfahrung, Menschenkenntnis und dem Bauchgefühl keinen Raum mehr geben. Dabei sei es wichtig, den Tatort mit allen seinen Sinnen in sich aufzunehmen. Und das macht Holtz in einer ruhigen und zurückhaltenden Art. Ein hartgesottener Held á la James Bond ist er nicht. Als er mit einem Helikopter für die Ermittlungen auf ein Kreuzfahrtschiff, das sich auf hoher See befindet, heruntergeseilt wird, hängt er grün im Gesicht buchstäblich in den Seilen. Als er einem Verdächtigen hinterherläuft, hechelt er wie „in einem Atemkurs für Geburtsvorbereitung“. Zudem hat er ein mustergültig kaputtes Privatleben, zwischenmenschlich ist er auch nicht der Fitteste. Und als Krönung fängt er in „Tote reden nicht“ eine Affäre mit einer Mordverdächtigen an. Warum lässt Gyllander seinen Helden so erbärmlich und unprofessionell erscheinen? „Alle Menschen haben Schwächen, niemand ist perfekt“, nimmt Gyllander seinen Helden in Schutz. „Und außerdem arbeiten tatsächlich solche schräge Typen bei der Polizei“. Er habe sogar noch untertrieben, hätte er tatsächlich beschrieben, was ihm tagtäglich in den Fluren bei der Polizei begegnet, würde ihm das niemand glauben, erzählt Gyllander freimütig. Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind also nicht zufällig. Dass seine Kollegen dennoch nach wie vor gut auf ihn zu sprechen sind, verdankt er der Tatsache, dass sie so „hartgesotten sind, dass alles an ihnen abperlt“.
Wenn er tagsüber nur mit Verbrechen zu tun hat, warum schreibt Gyllander dann abends noch einen Krimi? „Ich bin nicht von Verbrechen fasziniert, ich verabscheue sie. Mich interessieren nur die psychologischen Hintergründe.“ Rasante Verfolgungs-jagden, wilde Schießereien, Actionszenen findet man daher nur auf wenigen Seiten in Gyllanders Büchern. Er erzeugt Spannung, indem er in die Gefühls- und Gedankenwelt aller seiner Figuren schlüpft, auch in die der Täter. Dabei taucht er so intensiv in die gefühlsmäßigen Abgründe eines Mörders ein und hat als Autor so viele Morde auf seinem Gewissen, dass man sich unweigerlich fragt, ob er nicht auch selber mal Mordgelüste verspürt hat, mal so richtig wütend auf jemanden gewesen ist, dass er ihn am liebsten umgebracht hätte. „Ja“, gibt er offen zu, solche Gefühle kenne er auch, „jeder von uns ist zu einem Verbrechen fähig. Was die meisten von uns von diesem letzten Schritt zurückhält, ist die Tatsache, dass wir gelernt haben, mit Aggressionen und Gewalt umzugehen.“
Schuldlos schuldig
Gyllander ist ein Meister darin, falsche Spuren zu legen. Glaubt man, dem Mörder wegen erdrückender Beweise auf die Schliche gekommen zu sein, wendet sich das Mordsblatt schon auf der nächsten Seite. Viele dieser falschen Spuren entwickelt Gyllander beim Schreiben. „Das ist auch für mich spannend, da ich ja der erste bin, der erfährt, was passiert“, lächelt er.
Das Ende ist so überraschend, dass man nachdenklich das Buch aus der Hand legt. Man entwickelt Verständnis für den Täter, der irgendwie schuldlos schuldig ist. Ist es nicht eine Gratwanderung, bei einem brutalen Verbrechen Sympathie für den Täter zu empfinden? „Jeder Täter hat eine Geschichte, die ihn von Kindesbeinen an geformt hat, er ist selber häufig Opfer gewesen, dies alles kann jedem von uns passieren“, resümiert Gyllander. So plagt sich seine zweite Hauptfigur Pia Levin, die Kollegin von Ulf Holtz, mit schrecklichen Kindheitstraumata herum, die der Leser häppchenweise erfährt.
Gyllanders Figuren sind alle auf ihre Art und Weise einsam, wie kann man als Ehemann und Vater von zwei Kindern so viel über Einsamkeit Bescheid wissen? „Ich habe eine Höllenangst vor der Einsamkeit, deshalb lade ich alles auf meine Figuren ab, dann bin ich die Angst los“, verrät Gyllander seine größte Schwäche. Die Kinderpornografie macht ihm auch Angst. Und hier versteht er keinen Spaß. Es ist erschreckend, wenn Gyllander in seinem Buch beschreibt, wie unbedarft viele Familien Urlaubsfotos mit ihren nackten Kindern am Strand ins Netz stellen und gar nicht ahnen, wie Pädophile diese Fotos für ihre Zwecke missbrauchen.
Der erfolgreiche schwedische Krimiautor Henning Mankell hat seinen Kommissar Wallander nach dem zehnten Buch mit Alzheimer in den Ruhestand geschickt und auch das legendäre Krimiautorenpaar Sjöwall/Wahlöö haben von ihren Ermittlern nach Buch Nr. 10 Abschied genommen. Wie lange sein Team noch auf Spurensuche gehen wird, weiß Gyllander nicht, „wir gewöhnen uns gerade einander“. Welches Schicksal und welche persönliche Entwicklung auf sein Ermittlerduo warten, davon möchte er sich selber überraschen lassen.