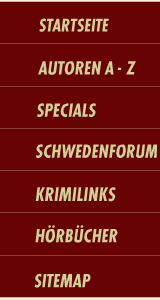Leseprobe Leseprobe
Kapitel 1Draußen vor meinem Fenster liegt der Schnee wie eine alles erstickende
Decke. Er sieht weich und schön aus, doch ich weiß, wie kalt
er ist. Ansehen, aber nicht anfassen. Betrachten, aber nicht teilnehmen.
Herr, ich habe solche Angst. Mehr als je zuvor. Ich suche, aber ich finde
nicht mehr.
Dabei ist Angst kein neues Gefühl für mich.
Ich glaube sogar, dass ich Pastorin wurde, weil ich so schreckliche Angst
vor Menschen habe.
Angst vor beinahe allem.
Am allermeisten ängstigt mich die Unbegreiflichkeit des Lebens. Dass
womöglich nirgends ein Sinn dahinter steht. Dass alles vielleicht
nur Einsamkeit und Leere ist. Sinnlose Illusion. Ich könnte verrückt
werden, wenn ich daran denke.
Schon als Kind haben mich solche Grübeleien hartnäckig verfolgt.
Die Gedanken hielten mich abends wach, während die Schatten an den
Wänden hochkrochen und immer bedrohlicher wurden. Warum?, dachte
ich. Und auf ein Warum folgte sofort ein neues Warum, bis ich am Ende
in der festen Gewissheit gefangen war: Eigentlich weiß es niemand.
Als ich klein war, habe ich nie verstanden, wie die Erwachsenen manche
Dinge so leicht abtun können, wie sie mit den Schultern zucken und
sagen können, so etwas passiert eben und keiner weiß, warum.
Als sei es völlig in Ordnung, Dinge nicht zu verstehen, keine Erklärung
zu haben, an die man sich halten kann.
Grüble nicht so viel darüber nach, Kind, sagte meine Mutter,
als mir nicht in den Kopf wollte, wie das Leben so hart, ungerecht und
launisch zuschlagen kann.
Dieses träge Hinnehmen der Unbegreiflichkeit des Lebens ängstigte
mich zum Verrücktwerden. Mehr noch als das Böse selbst. Das
Böse stellte ich mir als ein Ungeheuer vor, das die meiste Zeit in
einem Käfig gefangen ist. Damit konnte ich leben. Aber dass derjenige,
der den Käfig bewacht, offenbar keine klaren Regeln kennt, oder dass
man sich vielleicht grundsätzlich nicht auf ihn verlassen kann, das
war mehr, als ich verkraften konnte.
Es schneit immer noch. Ich sehe, wie jemand aus der Folkungagata kommend
den Hang heraufstapft und in die Erstagata einbiegt, in meine Straße.
Es scheint glatt zu sein. Mühsam, sich auf den Beinen zu halten.
Für mich war es auch immer mühsam, mich auf den Beinen zu halten.
Wir sprachen zu Hause nie über Gott oder Jesus. Weder meine Mutter
noch mein Vater sind gläubig. Was ich lernte, hatte ich aus der Schule.
Ich liebte die Geschichten aus der Bibel, die meine Lehrerin erzählte.
Weil sie nämlich eine Bedeutung hatten. Sie ergaben einen Sinn. Eine
Ordnung.
Als ich zehn Jahre alt war, begann ich heftig zu glauben, ohne jemandem
davon zu erzählen. Ich zeichnete einen alten Mann mit Flügeln
und einem langen Bart. Schnitt ihn aus und trug ihn dauernd mit mir herum.
Einen Mann aus Papier, zunehmend verknitterter und abgegriffener, den
ich Gott nannte. Damals fing ich an, mit dir zu sprechen, Herr. Stumm
sagte ich jeden Abend im Bett meine Gebete auf.
Ich hatte strenge Rituale, wie das vor sich zu gehen hatte. Die Worte
mussten nach einem bestimmten Muster gesprochen werden, sonst wären
sie wirkungslos gewesen.
Zeitweise war es richtig anstrengend. Wenn ich besonders große Furcht
hatte, dass mir oder dem Rest der Familie etwas
Schreckliches zustoßen könnte, zwang ich mich dazu, soundso
oft das Vaterunser zu beten. An bestimmten Stellen flocht ich persönliche
Bitten ein.
Lieber Gott, mach, dass es keinen Krieg gibt. Vater im Himmel, mach, dass
niemand von uns gefoltert wird. Lass Mama ein bisschen fröhlicher
sein. Mach, dass sie lacht, wenn Papa sich Mühe gibt, witzig zu sein.
Mach, dass Papa ein bisschen witziger ist. Lieber Gott, mach, dass sie
sich nicht scheiden lassen.
Wenn ich unterbrochen wurde, weil ein Flugzeug am Himmel vorbeizog oder
ein anderes Geräusch die abendliche Stille störte, musste ich
wieder ganz von vorn anfangen. Dachte wohl, dass bisher keiner zugehört
hätte. Oft war ich vor Erschöpfung den Tränen nahe, wenn
ich endlich fertig war. Im Haus war es dann ganz still geworden.
Keiner durfte etwas davon wissen. Meine Mutter hätte sich nur Sorgen
gemacht. Mein Vater hätte es als Spinnerei abgetan. Mein Bruder hätte
mich damit aufgezogen.
Mein Bruder, der in seinem Bett am anderen Ende des Zimmers lag, atmete
tief und sorglos unter seinen Postern mit Fußballhelden und Rockstars.
Ich war die Einzige, die wachte.
Ich war die Einzige, die versuchte, das Schlimme von uns fern zu halten.
Auf eine Art hast du, Herr, mich noch einsamer gemacht, als ich es ohnehin
schon war. Auf eine andere Art war ich nicht länger allein mit dem
Unbegreiflichen.
Wie es kam, dass es im Laufe der Jahre nachließ, weiß ich
nicht mehr genau. Die Unruhe war weiterhin da, aber ich gewöhnte
mich wohl daran, nehme ich an. Versuchte, die Ängste auf Abstand
zu halten, anstatt sie zu kontrollieren. Es war wie eine Gnade, dass es
mir fast gelang. Ich meisterte mein Dasein, ohne mich allzu anstrengenden
Ritualen zu unterwerfen. Es vergingen viele Jahre, die ganze Teenagerzeit
ging vorbei, ohne dass ich deine Hand suchte, um mich daran festzuhalten.
Ich erinnere mich genau an den Moment, in dem ich beschloss, dich wieder
zu suchen. Da war ich bereits eine erwachsene Frau. Hatte das Gymnasium
mit guten Zeugnissen hinter mich gebracht. War zu Hause ausgezogen, hatte
das verschlafene Avesta verlassen, wo ich aufgewachsen war. Studierte
Literaturwissenschaft an der Universität in Stockholm und lebte mein
eigenes Leben. War in mein Einzimmerappartement in Söder gezogen,
in dem ich heute noch wohne. Hatte Kommilitonen, mit denen ich nach den
Vorlesungen im Cafe saß.
Und ich hatte einen Mann geliebt.
| Buchtipp |
 |
Oder glaubte, einen Mann geliebt zu haben.
Micke und ich gaben uns wirklich Mühe. Keiner von uns hatte eine
vernünftige Erklärung dafür, warum wir nicht zusammen das
Glück erlebten, von dem wir so viel gehört hatten.
Wir imitierten die Liebe, sagten das, was von Verliebten erwartet wurde,
und kaschierten unsere Verwirrung und Ratlosigkeit, so gut es ging.
Nachts, wenn die Dunkelheit uns von unseren öffentlichen Rollen befreite,
konnten wir durchaus Lust und sinnliche Nähe empfinden. Aber am nächsten
Morgen sah ich dann am Frühstückstisch einen Mann vor mir, der
sein Müsli in sich hineinschaufelte und sich dabei gleichzeitig auf
eine entsetzlich abstoßende Weise räusperte.
Micke war ein guter Mensch, aber was ich vor allem an ihm wahrnahm, war
sein widerliches Räuspern. Unter anderem. Ebenso seine penibel geputzten
Schuhe. Dass seine Wangen so schuppig aussahen, wenn er sich rasiert hatte.
Dass er vor dem ersten Schluck zwanzigmal in seine Teetasse blies. Ich
hätte schreien mögen, dass der Tee doch gar nicht so schrecklich
heiß sein könne.
Es gab noch mehr von diesen störenden Kleinigkeiten. Ich verurteilte
mich hart dafür, dass ich mich an ihnen stieß.
Andererseits phantasierte ich manchmal davon, wie geschmeidig und glatt
sich wohl der Rücken eines wildfremden Mannes anfühlen mochte.
Oder schlimmer noch - eines Mannes, den ich überhaupt nicht respektierte,
den ich nicht mal sympathisch fand. Wie gierig seine Hände über
meine Haut glitten und wie sehr es mir gefiele, dass er mich fest und
rücksichtslos anpackte. Micke war ja so behutsam. In meiner Phantasie
stopfte ich ihm mit wütenden Fingern seine Behutsamkeit in den Hals.
Das schien mir alles völlig unlogisch zu sein, und es erschreckte
mich.
Ich konnte mich nicht mit Micke abfinden, konnte für ihn nicht fühlen,
was ich hätte fühlen sollen. Ich glaube, letztlich haben wir
uns getrennt, um nicht länger unsere eigene Einsamkeit in den Augen
des anderen sehen zu müssen. Es war nur noch eine Qual.
Was er dachte und wie er fühlte, weiß ich natürlich nicht
mit Sicherheit. Wir sprachen ganz vernünftig über unsere Unreife
als Erklärung für unser ausgebliebenes Liebesglück und
waren uns überhaupt ganz beflissen einig bei unserer einvernehmlichen
Trennung. Lobten und priesen unsere gute Freundschaft, die sich nur noch
mehr festigen würde, jetzt, da wir alle romantischen Ambitionen aufgegeben
hatten.
Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Ich habe seitdem nie wieder etwas
von ihm gehört.
Obwohl es nicht der abgerissene Kontakt war, der mich danach mehr als
ein Jahr lang ungeheuer deprimiert sein ließ. Es war eher so, dass
mir die Liebe sinnlos und armselig vorkam.
Ich versuchte mich damit zu trösten, dass die Liebe sicher groß
und mächtig gewesen war und dass unsere Beziehung durch unsere eigene
Schuld in die Brüche gegangen war. Dass er versagt hatte, dass ich
versagt hatte, dass der Fehler allein bei uns lag.
Obwohl, wenn ich mich umsah, gab es so wenig an Vertrauen und guten Kräften
in der Sphäre, in der die Liebe zu Hause sein sollte.
Danke an den Krüger Verlag für die Veröffentlichungserlaubnis. |