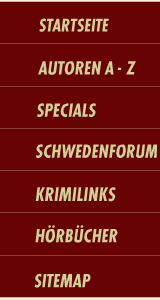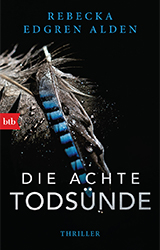Die Stockholmer haben genug von Planungswut und supermoderner Architektur.
Und finden sogar am Wildwuchs Gefallen!
Ausgerechnet in dem Jahr, da ganz Europa auf die Kulturhauptstadt schaut.
Übrigens, einer hat das Malheur der Städteplaner vorhergesehen:
Kommissar Beck.
Januar in Stockholm. Endlich gehen die ganz dunklen Wochen vorüber, die Tage, an denen eine morgendliche blütenweiße Schneeschicht sich vormittags in eine grauschwarze, klatschnasse Pampe und abends in eine spiegelglatte Rutschfläche verwandelt. Jetzt nimmt der Winter die schwedische Hauptstadt voll in den Griff. Die großen Wasserflächen, die diese Inselstadt durchziehen, verwandeln sich in weite Schnee- und Eisfelder. Zwar besitzt die niedrige Sonne nur fahle Leuchtkraft, doch der Schnee reflektiert um so stärker die vielen Lichter der Großstadt.
Auch für Kommissar Beck würden nun wohl bessere Zeiten anbrechen.
Überwunden hätte er den zweiten Schnupfen der Saison, der ihn an seine Wohnung in Gamla Stan, der Stockholmer Altstadt, gefesselt hätte. Nun würden ihm die glasklare Winterluft und die frischen Brisen, die vom Meer her in die Stadt wehen, Erleichterung bringen.
Martin Beck wäre inzwischen Mitte 70 und pensionierter Cheffahnder der Reichsmordkommission. Als alter Fuchs würde er das Jagen jedoch nie ganz aufgeben können. Sicher würde er sich alte Akten nach Hause holen und in ungeklärten Mordfällen herumstöbern. Vor allem hätte ihn all die Jahre hindurch der vermeintliche Dilettantismus beschämt, mit dem nach dem Mörder Olof Palmes gesucht und vermutlich der wahre Hintergrund der Tat, die Schweden erschüttert hat, verschleiert wird. Daß nun schon wieder der bereits einmal verurteilte und einmal freigesprochene Outlaw Christer Pettersson als Mörder vorgeführt wird, daß dafür die Ermittler vier bislang unbekannte Zeugen, die zwölf Jahre lang "aus Angst" geschwiegen hatten, aus dem Hut zauberten - das alles würde einen Martin Beck kaum überzeugen können.
Von Beck selbst allerdings fehlt seit Mitte der siebziger Jahre jede Spur.
Damals vollendete das Schriftstellerpaar Maj Sjöwall und Per Wahlöö
kurz vor Wahlöös Tod den letzten von zehn Kriminalromanen, in
denen Kommissar Beck die Hauptrolle spielte. In den beiden letzten Folgen
zeichnete sich ab, daß es Beck wohl nicht mehr lange im Dienst halten
würde. Die Lust war weg, verdrängt durch Routine und Ärger.
Zudem hatte sich der Polizeiapparat gewandelt: Becks Typ war nicht mehr
gefragt. Lennart Kollberg, sein bester Kollege, hatte die Brocken schon
frustriert hingeschmissen. Die Zukunft gehörte den Gunvald Larssons,
den handfesten Polizisten, die mit der Faust, nicht mit dem Kopf ermittelten.
Der Wandel im Erscheinungsbild der Stockholmer Polizei, den die Krimiautoren so präzise beschrieben, war paradigmatisch: Die schwedische Gesellschaft, im europäischen Vergleich eine friedliche Idylle, veränderte sich immer deutlicher. Die Atmosphäre wurde rauher. Was bislang undenkbar war, wurde möglich - sogar der Mord an einem Ministerpräsidenten. Das alles ließen damals, Mitte der siebziger Jahre, Sjöwall und Wahlöö ihren Kommissar ahnen.
Sie brauchten nur aus dem Fenster zu schauen. Die Veränderungen, die das gemütliche Volksheim Schweden in einen wirtschaftlich und sozial anfälligen, also in einen ganz normalen Staat am Außenrand Europas verwandelten, waren auf der Bühne der Stadt Stockholm zu beobachten. Dieses Jahr ist sie europäische Kulturhauptstadt. Die Stadt selbst und ihre Metamorphosen ist eines der Hauptthemen des Kulturjahres.
"Wenn Sie sich heute die City von Stockholm anschauen, dann bekommen Sie den Eindruck, daß hier ein Krieg gewütet hat." Das sagt Magnus Andersson, Sekretär im Stadtplanungsamt. Er ist ein Planer der jüngeren Generation, der sich kritisch mit den Fehlern der vergangenen Jahrzehnte auseinandersetzt.
Die zugige, unwirtliche Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und dem zentralen Platz Sergels Torg, einst ein dichtes Altstadtviertel, ist entvölkert. Obwohl Stockholm nie die Zerstörungen eines Krieges erfahren hat, gibt es in der City nur noch wenige Gebäude, die älter als 40 Jahre alt sind. Große Büro- und Warenhäuser haben die Mietshäuser verdrängt. Breite Verkehrsschneisen durchziehen die Stadt, die sich über die Inseln an der Mündung des Mälarsees in die Ostsee erstreckt. Sie sind über spektakuläre Brücken miteinander verbunden, auf denen der Autoverkehr Vorfahrt hat.
Das ist das Werk von Stadtplanern der sechziger Jahre. Von der Politik großzügig unterstützt, konnten sie ihren Traum von der totalen Modernisierung weitgehend verwirklichen. Strikte Trennung von Wohn- und Arbeitsort, Beschleunigung der Straßen, dazu der Bau von einer Million Wohnungen im Acht-Millionen-Reich innerhalb von zehn Jahren und vor allem an den Rändern der Großstädte - kein Ziel schien zu groß. Die Radikalität der Planungen faszinierte weltweit, begründete den Ruf Stockholms als eine der Metropolen der Moderne schlechthin, erschien mit den Jahren aber immer fragwürdiger.
Fünf Trompetenstöße für die Moderne sollten sie sein,
die fünf Bürohochhäuser am Anfang von Sveavägen im
Herzen der Stadt. Für die Häuser wurde ein ganzes Altstadtquartier
rasiert. Zugleich entstand die erste Fußgängerzone Nordeuropas,
für alle Stockholm-Besucher bis weit in die siebziger Jahre ein Faszinosum.
Eine Betonschlucht durchschneidet die Stadt
Ein weiteres Symbol für die Grenzenlosigkeit der damaligen Veränderungswut
ist die Autobahn, die in einer Betonschlucht zwischen den Inseln Gamla
Stan und Riddarholmen das historische Zentrum der Stadt durchschneidet.
Parallel verläuft die Eisenbahnzufahrt zum Hauptbahnhof. So rollt
der Verkehr in breitem Strom quer durch eines der schönsten Stadtpanoramen,
die Europa zu bieten hat. Es waren die Jahre des "human engineering".
Der schwedische Sozialstaat entwickelte sich zu voller Blüte. Allen
Bürgern versprach er vollständige Absicherung von der Wiege
bis zur Bahre. Das erforderte genaue Planung und Unterwerfung des einzelnen
unter das, was sich die Planer ausdachten. Im Mai 1971 bekam das Bild
erste Risse. Mitten in den zentralen Park Kungsträdgården wollten
die Planer breit und satt einen Zugang zur Tunnelbana, der U-Bahn, klotzen.
Das war für viele dann doch zu herbe. Einige Stockholmer ketteten
sich an die alten Ulmen, die dem Neubau weichen sollten. So etwas hatte
die Stadt noch nicht gesehen.
| Buchtipp |
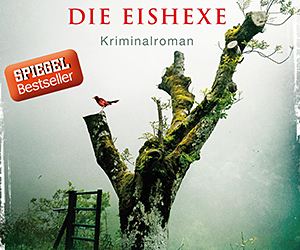 |
Auch Kommissar Beck ließen Sjöwall und Wahlöö am
eigenen Leib miterleben, was die mit Verve betriebene Modernität
für den einzelnen bedeutete. Als typische Kleinfamilie lebte er
mit Frau, Tochter und Sohn mehr oder weniger unglücklich in Skärmarbrink,
einer jener Satellitenstädte, die damals im Jahrestakt entlang
der Tunnelbana-Linien aus dem Boden gestampft wurden. Im Lauf der Zeit
entfremdete sich Beck von seiner Frau, bis er es eines Tages nicht mehr
aushielt. Auf heftiges Zuraten seiner Tochter zog er aus und nahm sich
die Wohnung in Gamla Stan.
Mit der Reichsmordkommission mußte er irgendwann Anfang der Siebziger
in das hypermoderne Polizeidirektionsgebäude auf Kungsholmen umziehen.
Vom ersten Tag an haßte Beck diese Büromaschine aus Stahl
und Beton, bei der alles auf Funktionalität und nichts aufs Wohlgefühl
abzielt. Die Undurchdringlichkeit dieses Gebäudes symbolisiert
zugleich die neuen Methoden der schwedischen Polizei, so wie sie Sjöwall/Wahlöö
geschildert haben: Überwachung, Absicherung des ganzen Landes mit
Hilfe des Computers.
Hundert Sprachen in einer einzigen Schule
Das Verhältnis von Mensch und Natur möchten die Stadtplaner
ebenso positiv beeinflussen wie das von Mensch und Mensch. Ein Schreckwort
lautet Segregation, das Verdrängen ethnischer oder sozialer Minderheiten
in die jeweiligen Ghettos. Ein extremes Beispiel ist der Vorort Rinkeby,
in dem 90 Prozent der Bewohner Einwanderer sind; in der dortigen Volksschule
werden 100 Sprachen gesprochen. Zugleich muß die schwedische Gesellschaft,
die seit Jahren in der Wirtschaftskrise steckt, anerkennen, daß
auch sie nicht frei von Rassismus ist.
"Wir wollen mehr als früher darauf achten, daß überall
eine bessere Mischung entsteht", sagt Magnus Andersson. Noch vor 30
Jahren galt die räumliche Trennung von Wohnung, Arbeitsplatz, Einkaufszentrum
als Ideal. Jetzt wollen die Stadtplaner neben die Hochhäuser der
Großsiedlungen niedrige Villen setzen und in den reinen Schlafstädten
Betriebe ansiedeln.
"Ich glaube, daß die Generation, die 30 Jahre
jünger ist als wir, eine ganz andere Mentalität besitzt. Die
lassen sich nicht reinlegen. Sie stellen die Dinge in Frage, sind kritischer
als meine Generation."
Das sagt Maj Sjöwall, inzwischen 62 Jahre alt.
Sie selber zählt sich zu den ersten, die begannen, das Handeln
der Behörden und Autoritäten zu hinterfragen. Schweden, so
meint sie, habe eine paternalistische Tradition. Woher das kommt, das
vermag sie selbst nicht richtig zu sagen. Aber die Dinge sind in Bewegung,
sie habe die Hoffnung auf Besserung, die sie unter anderem von ihren
eigenen Kindern und Enkeln beziehe. Sie selbst lebt weiterhin als freie
Übersetzerin und Gelegenheitsjournalistin. Lust zum Schreiben,
so sagt Maj Sjöwall, habe sie noch immer, es fehlten aber die Ambitionen.
Kein Wunder, wer einmal den Kriminalroman revolutioniert hat, der hat
seine Schuldigkeit getan. "Jetzt bin ich eher faul und schlafe aus,
wenn ich es möchte. Aus der Öffentlichkeit halte ich mich
nach Möglichkeit heraus."
Dem Kulturjahr 1998 sieht die Autorin mit Skepsis entgegen. Es würden
nun Aktionen lauthals verkündet, die ohnehin stattgefunden hätten.
Die Stadt würde aufpoliert - "aber eigentlich zahlen wir doch Steuern,
damit so etwas ständig gemacht wird". Ganz anders sieht es naturgemäß
Jan Sandquist, Informationschef der Aktiengesellschaft "Kulturhauptstadt
1998". Der polyglotte ältere Herr sitzt mitten im quirligen Hauptquartier,
einem barocken Gebäude am Kungsträdgård, und dirigiert Anfragen
aus aller Welt mit Eleganz und Ruhe. Immer wieder scheint es, als könne
er die Dimensionen, die das Kulturjahr angenommen hat, selbst nicht
fassen. "1000 Veranstaltungen umfaßt unser Katalog", betont er
mehrmals und läßt sich die Zahl auf der Zunge zergehen.
Stockholm, am Jahresbeginn 1998. Exkommissar Beck würde der Trubel
um die Kulturhauptstadt wohl eher nur am Rande interessieren. Stockholm
ist für ihn ganz selbstverständlich die Stadt, für ihn,
der sein Stockholm liebt und manchmal haßt, wie es eben nur jemand
lieben und hassen kann, der hier sein Leben verbracht und tiefe Wurzeln
geschlagen hat. Wenn wir uns genug Zeit nehmen würden, wenn wir
in Ruhe über die Kopfsteinpflaster von Gamla Stan schlenderten
oder die steilen Abhänge in Söder- oder Norrmalm hinauf- oder
hinabrutschten, dann würde er vielleicht irgendwann vor uns quer
über die Straße laufen: Martin Beck im verknautschten Regenmantel,
vielleicht mit einer vergilbten Aktenmappe unterm Arm, vielleicht in
Begleitung eines Hundes, vielleicht auch an einem der vielen Küstenpfade
Stockholms, versonnen auf eines der vielen alten Schiffe blickend, die
das langsam wachsende Eis nun für einige Monate ans Ufer fesselt.
Autor: Johannes Wendland
Das Literaturportal schwedenkrimi.de - Krimikultur Skandinavien bedankt
sich für die Veröffentlichungserlaubnis. |